Der ESF als Mittel zur Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen
Der Europäische Sozialfonds (ESF) ist einer der Strukturfonds der EU, die eingerichtet wurden, die Unterschiede bei Wohlstand und Lebensstandard in den Mitgliedstaaten und Regionen der EU abzubauen und dadurch den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu fördern.
Der ESF dient der Förderung der Beschäftigung in der EU. Er steht den Mitgliedstaaten zur Seite, wenn es darum geht, Europas Arbeitskräfte und Unternehmen für die neuen und globalen Herausforderungen zu rüsten. Kurz gesagt:
- Das Geld fließt in die Mitgliedstaaten und Regionen, insbesondere jene, deren wirtschaftliche Entwicklung am wenigsten fortgeschritten ist.
- Er ist ein Kernstück der EU-Strategie 2020 für Wachstum und Beschäftigung zur Verbesserung der Lebensbedingungen der EU-Bürger durch höhere Qualifizierung und bessere Berufsaussichten.
- Im Zeitraum 2007-2013 vergibt der ESF Mittel von rund 75 Mrd. Euro an Mitgliedstaaten und Regionen in der EU.
Perspektiven des ESF
Die Strategie für Wachstum und Beschäftigung ist und bleibt die wichtigste EU-Strategie zur Sicherung des Wohlstands in Europa. Im Rahmen der Europäischen Beschäftigungsstrategie arbeiten 27 Mitgliedstaaten gemeinsam daran, Europas Fähigkeit zur Schaffung angemessener Arbeitsplätze zu verbessern und Menschen mit den erforderlichen Qualifikationen auszustatten, um sie besetzen zu können. Unter diesen strategischen Leitlinien wendet der ESF Mittel auf, um die gesetzten Ziele zu erreichen.
Partnerschaft mit dem ESF
Strategie und Budget des ESF werden zwischen den EU-Mitgliedstaaten, dem Europäischen Parlament und der Kommission verhandelt und beschlossen. Auf dieser Grundlage werden von den Mitgliedstaaten gemeinsam mit der Europäischen Kommission für einen siebenjährigen Zeitraum operationelle Programme geplant.
Diese operationellen Programme werden dann mithilfe eines breiten Spektrums an Organisationen aus dem öffentlichen und privaten Bereich durchgeführt. Zu diesen Organisationen gehören nationale, regionale und lokale Behörden, Einrichtungen für allgemeine und berufliche Bildung, Nichtregierungsorganisationen (NRO) und der gemeinnützige Sektor sowie Sozialpartner, wie etwa Gewerkschaften und Betriebsräte, Industrie- und Berufsverbände, sowie auch einzelne Unternehmen.
50er Jahre: Beginn des Europäischen Sozialfonds
 1951 unterzeichneten Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg den Vertrag von Paris zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS). Der aus dem EGKS-Vertrag hervorgegangene Fonds für die Umschulung und Wiedereingliederung von Arbeitnehmern (EKGS-Fonds) war Vorläufer des Europäischen Sozialfonds (ESF).
1951 unterzeichneten Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg den Vertrag von Paris zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS). Der aus dem EGKS-Vertrag hervorgegangene Fonds für die Umschulung und Wiedereingliederung von Arbeitnehmern (EKGS-Fonds) war Vorläufer des Europäischen Sozialfonds (ESF).
1957 wurde mit dem Vertrag von Rom nicht nur die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), sondern auch der ESF ins Leben gerufen, der zur Verbesserung der Berufschancen in der Gemeinschaft durch Förderung von Beschäftigung sowie zur geografischen und beruflichen Mobilität von Arbeitnehmern beitragen sollte.
Anfänglich wurden die ESF-Mittel zum „Ausgleich“ von Arbeitsplatzverlusten verwendet. Beschäftigte in Wirtschaftszweigen, die von Umstrukturierungen betroffen waren, erhielten Unterstützung in Form von Umschulungszuschüssen. Außerdem wurde Arbeitslosen, die ihre Region verließen, um anderswo einen Arbeitsplatz zu finden, Wiedereingliederungshilfe gezahlt. Da der ESF alle Sektoren außer der Landwirtschaft umfasste, konnte er umfassender eingesetzt werden als der EKGS-Fonds.
60er Jahre: Arbeitslosigkeit und Zuwanderung
 Da in der Anfangszeit keine übergreifende EU-Strategie existierte, wurde der ESF zur Bewältigung einzelstaatlicher Probleme eingesetzt.
Da in der Anfangszeit keine übergreifende EU-Strategie existierte, wurde der ESF zur Bewältigung einzelstaatlicher Probleme eingesetzt.
Das Europa der 50er und 60er Jahre zeichnete sich durch eine florierende Wirtschaft aus, in der man Arbeitslosigkeit nur in Ausnahmefällen begegnete. Auf Italien jedoch entfielen mit fast 1,7 Millionen beschäftigungslosen Menschen annähernd 66 % der Arbeitslosigkeit in der EWG. Zwischen 1955 und 1971 verließen nicht weniger als 9 Millionen Menschen Süditalien auf der Suche nach Arbeit und wanderten in den industrialisierten Norden des Landes oder sogar ins Ausland ab. Italiener waren somit die Hauptbegünstigten von Umschulungszuschüssen und Wiedereingliederungshilfen des ESF. Die Bundesrepublik Deutschland andererseits verwendete ESF-Mittel zur Umschulung von Beschäftigten, die einen Arbeitsunfall erlitten hatten.
Zu dieser Zeit mussten ESF-Mittel bereits an die finanziellen Beiträge der einzelnen Mitgliedstaaten angepasst werden und flossen in Projekte des öffentlichen Sektors. Für Privatunternehmen standen keine ESF-Mittel zur Verfügung.
70er Jahre: Berücksichtigung der Bedürfnisse spezifischer Gruppen
 Eine Reform des ESF stand 1971 an. Mittel kamen nun gezielt bestimmten Personengruppen zugute, und zugleich wurde der Haushalt aufgestockt. Bauern und Landarbeiter, die der Landwirtschaft den Rücken kehrten, konnten ab 1972 gefördert werden. Ab 1975 standen ESF-Mittel auch für die Bekleidungsindustrie zur Verfügung.
Eine Reform des ESF stand 1971 an. Mittel kamen nun gezielt bestimmten Personengruppen zugute, und zugleich wurde der Haushalt aufgestockt. Bauern und Landarbeiter, die der Landwirtschaft den Rücken kehrten, konnten ab 1972 gefördert werden. Ab 1975 standen ESF-Mittel auch für die Bekleidungsindustrie zur Verfügung.
1975 wurde der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geschaffen. Während seine Hauptaufgabe die Infrastrukturentwicklung wirtschaftlich rückständiger Regionen war, konzentrierte sich der ESF darauf, Menschen in ganz Europa den Erwerb neuer Qualifikationen zu ermöglichen. Beide Fonds wurden als „Strukturfonds“ bezeichnet.
Bis Ende der 70er Jahre hatte die Jugendarbeitslosigkeit stark zugenommen, deren Bekämpfung ein Schwerpunkt des ESF wurde. Als Antwort auf die steigende Zahl berufstätiger Frauen wurden nun auch Frauen stärker unterstützt – etwa beim Verlust ihres Arbeitsplatzes, beim Eintritt in den Arbeitsmarkt oder bei Rückkehr in das Erwerbsleben nach einer Unterbrechung.
Außerdem förderte der ESF nach und nach weitere Gruppen, zum Beispiel Behinderte und ältere Arbeitnehmer über 50.
Durch Konzentration auf spezifische Gruppen beschränkte sich die Zusammenarbeit des ESF nicht mehr ausschließlich auf öffentliche Organisationen, sondern weitete sich auch auf Arbeitgeber und Gewerkschaften bis hin zu einzelnen Unternehmen aus. Dies führte zu einer grundlegend verschiedenen Arbeitsweise des ESF. Bis dahin hatten die Mitgliedstaaten Projekte durchgeführt, deren Kosten nach Projektende erstattet wurden. Nunmehr mussten Projekte vorab genehmigt werden. Somit wurde ein Prozess in Gang gesetzt, in dem Europäische Kommission und Mitgliedstaaten europaweit gemeinsame Prioritäten setzten, für die Mittel zur Verfügung gestellt wurden.
80er Jahre: Übergang von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft
 Der Niedergang traditioneller Branchen wie Stahlindustrie, verarbeitendes Gewerbe und Schiffbau, in Verbindung mit der Entstehung neuer Technologien, insbesondere im Dienstleistungsbereich, führte zu einer hohen Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften. ESF-Schwerpunkte wurden Berufsbildung und Schulung in der Anwendung neuer Technologien.
Der Niedergang traditioneller Branchen wie Stahlindustrie, verarbeitendes Gewerbe und Schiffbau, in Verbindung mit der Entstehung neuer Technologien, insbesondere im Dienstleistungsbereich, führte zu einer hohen Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften. ESF-Schwerpunkte wurden Berufsbildung und Schulung in der Anwendung neuer Technologien.
ESF-Mittel wurden für Jugendliche zur Verfügung gestellt, die aufgrund fehlender oder unzureichender Berufsausbildung schlechte Berufsaussichten hatten, sowie für Langzeitarbeitslose. Die Förderung wurde auf Schulabbrecher ausgedehnt, und auch Frauen erhielten beim Zugang zum Arbeitsmarkt Unterstützung.
Eine wichtige Änderung im Förderzeitraum 1983-1988 bestand im Wegfall der Bestimmung, dass Personen nach ihrer Umschulung eine mindestens sechs Monate währende ausbildungsbezogene Tätigkeit aufnehmen mussten. Dies spiegelte die Realität eines Arbeitsmarktes im Umbruch wider und machte für den ESF den Weg frei, Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für alle Bereiche der Wirtschaft anzubieten.
In Griechenland, Portugal und Spanien – Ländern mit dominierendem Landwirtschaftssektor –, lag das Pro-Kopf-Einkommen erheblich unter dem EU-Durchschnitt. 1983 wurde entschieden, ESF-Fördermittel besonders bedürftigen Regionen zur Verfügung zu stellen. Die ESF-Reform des Jahres 1988 sollte den Regionen mit dem größten Entwicklungsrückstand zugute kommen. Bis Ende der 80er Jahre flossen mehr als die Hälfte der ESF-Mittel in ärmere Regionen und Länder wie Andalusien, die Kanarischen Inseln, Griechenland, die französischen überseeischen Departements, Irland, Süditalien, Nordirland und Portugal.
1988 kam es erneut zu einer Reform des ESF. Bis dahin bestand der Beitrag des ESF in Maßnahmen, die im Wesentlichen im nationalen Kontext der Mitgliedstaaten bestimmt wurden. Für jedes Projekt mussten die Mitgliedstaaten jedoch der Kommission einen Antrag vorlegen, der dann geprüft und gegebenenfalls genehmigt wurde. Dadurch wurde die Verwaltung des ESF für Mitgliedstaaten und Europäische Kommission immer schwerfälliger.
Durch die Reform ergab sich eine Verschiebung von (einzelnen) Projekten, die in einem nationalen Kontext verfolgt wurden, hin zu einer mehrjährigen Ausrichtung, die auf einem partnerschaftlichen Übereinkommen zwischen Mitgliedstaaten und der Kommission basierte. 1988 entschied sich die EU für einen Wechsel von einem Jahreshaushalt zu einer mittelfristigen Finanzplanung (1988/1989-1993). Die Mitgliedstaaten begannen mit dem Austausch von Beschäftigungsdaten und -strategien, sodass der ESF in einzelstaatliche Arbeitsmarktmaßnahmen eingebunden werden konnte.
Mit dieser Reform war der ESF in der Lage, seine Anstrengungen auf die bedürftigsten Regionen oder Personengruppen zu konzentrieren, während der Grundsatz gestärkt wurde, dass Gemeinschaftsfinanzierung lediglich als Ergänzung nationaler Maßnahmen zu verstehen ist.
Außerdem wurden die ESF-Mittel aufgestockt. Mithilfe des ESF konnten jährlich über 2 Millionen Menschen an beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen oder fanden einen Arbeitsplatz.
90er Jahre: Globalisierung und Informationsgesellschaft
 Nachdem sich 1994 angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit die EU auf eine Beschäftigungsstrategie geeinigt hatte, führte der Vertrag von Amsterdam von 1997 zur Schaffung eines Rahmens für beschäftigungspolitische Leitlinien sowie einer gemeinsamen Strategie. Der ESF verschob seinen Akzent von der Arbeitslosigkeit zur Beschäftigung, insbesondere im Hinblick auf den Erhalt von Arbeitsplätzen und den beruflichen Aufstieg von Beschäftigten. Im Mittelpunkt des ESF standen jetzt Weiterbildung, die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Berufsorientierung und -beratung.
Nachdem sich 1994 angesichts der steigenden Arbeitslosigkeit die EU auf eine Beschäftigungsstrategie geeinigt hatte, führte der Vertrag von Amsterdam von 1997 zur Schaffung eines Rahmens für beschäftigungspolitische Leitlinien sowie einer gemeinsamen Strategie. Der ESF verschob seinen Akzent von der Arbeitslosigkeit zur Beschäftigung, insbesondere im Hinblick auf den Erhalt von Arbeitsplätzen und den beruflichen Aufstieg von Beschäftigten. Im Mittelpunkt des ESF standen jetzt Weiterbildung, die Schaffung von Arbeitsplätzen sowie Berufsorientierung und -beratung.
Der ESF befasste sich jedoch auch weiterhin mit der Aus- und Weiterbildung von Jugendlichen, Arbeitslosen und denen, die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen waren. Mit einer immer älter werdenden Bevölkerung in Europa bewilligte der ESF zudem mehr Mittel zur Fortbildung älterer Menschen am Arbeitsplatz oder zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt. Unterstützt wurden auch Initiativen zur Betreuung älterer Menschen, um Familienangehörigen die Chance zu geben, erwerbstätig zu bleiben oder an den Arbeitsplatz zurückzukehren.
Außerdem dienten 5 % des ESF-Haushalts zur Finanzierung innovativer Programme, zur Effizienzsteigerung ESF-finanzierter Projekte und zum Erfahrungsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten, um eine europaweite Verbreitung von Innovation zu ermöglichen. Diese Initiativen haben zur Einrichtung von drei wichtigen Gemeinschaftsprogrammen geführt:
- EUROFORM als Experiment mit neuen Formen der Berufsausbildung und Beschäftigung;
- HORIZON zur Ausbildung Behinderter;
- NOW (New Opportunities for Women) zur besseren Eingliederung bzw. Wiedereingliederung von Frauen in den Arbeitsmarkt.
Neue Programme zu spezifischen arbeitsmarktpolitischen Fragen und zur Förderung des transnationalen Austauschs von Ideen und Konzepten wurden ins Leben gerufen:
- YOUTHSTART zur Unterstützung von Jugendlichen ohne abgeschlossene Ausbildung beim Berufseinstieg;
- INTEGRA zur Unterstützung bestimmter Gruppen wie Alleinerziehenden, Wohnsitzlosen, Flüchtlingen, Strafgefangenen und Haftentlassenen bei der Suche nach einem sicheren Arbeitsplatz und zur Bekämpfung von Diskriminierungen in Berufsausbildung und Beschäftigung aus Gründen der Rasse oder aus sonstigen Gründen;
- ADAPT zur Unterstützung von Menschen bei der Anpassung an den Wandel in Unternehmen und Industrie, z. B. durch Weiterbildung im Bereich Informationstechnologien.
Im Zeitraum 1994-1999 wurde die finanzielle Ausstattung der Strukturfonds im Vergleich zur vorangehenden Förderperiode 1988-1993 nahezu verdoppelt. Fast 70 % der Mittel kamen Regionen zugute, die Hilfe am meisten benötigten. 1994 wurde parallel zu den Strukturfonds der Kohäsionsfonds eingeführt, um ärmere EU-Staaten bei der Entwicklung von Umweltschutz- und Verkehrsinfrastrukturprojekten zu unterstützen.
21. Jahrhundert: Unterstützung der Strategie von Lissabon und der Europäischen Beschäftigungsstrategie
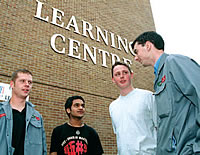 Im Jahr 2000 verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union die Lissabon-Strategie, um die EU bis 2010 zum fortschrittlichsten wissensbasierten Wirtschaftsraum zu machen. Unter anderem sollte eine Gesamtbeschäftigungsquote von 70 % und eine Frauenerwerbsquote von über 60 % angestrebt werden. Ein weiteres Ziel wurde später hinzugefügt: Steigerung der Erwerbsquote älterer Arbeitnehmer auf 50 % bis 2010.
Im Jahr 2000 verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union die Lissabon-Strategie, um die EU bis 2010 zum fortschrittlichsten wissensbasierten Wirtschaftsraum zu machen. Unter anderem sollte eine Gesamtbeschäftigungsquote von 70 % und eine Frauenerwerbsquote von über 60 % angestrebt werden. Ein weiteres Ziel wurde später hinzugefügt: Steigerung der Erwerbsquote älterer Arbeitnehmer auf 50 % bis 2010.
Der ESF beschloss für den Zeitraum 2000-2006 zur Unterstützung der Lissabon-Strategie folgende Prioritäten:
- Durchführung aktiver arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen zur Vermeidung und Bekämpfung von Arbeitslosigkeit;
- Schaffung von Chancengleichheit durch besseren Zugang zum Arbeitsmarkt;
- Verbesserung der allgemeinen und beruflichen Bildung, als Teil der Strategie des lebenslangen Lernens für einen besseren Zugang zum Arbeitsmarkt, zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und zur Förderung der beruflichen Mobilität;
- Verbesserung der Qualifikation und Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer und neue Formen der Arbeitsorganisation;
- Förderung des Unternehmertums und Verbesserung der Rahmenbedingungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen.
Über positive Maßnahmen zugunsten der Beteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt hinaus führte der ESF das „Gender Mainstreaming“ ein und rief 2000 die EQUAL-Initiative ins Leben als Versuchsprogramm zur Entwicklung neuer Formen der Bekämpfung von Diskriminierung und Ungleichbehandlung auf dem Arbeitsmarkt sowie zur Förderung eines integrationsförderndes Arbeitslebens durch Bekämpfung von Diskriminierung und Ausgrenzung aus Gründen des Geschlechts, der Rasse oder ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung.
Der Schwerpunkt des laufenden Zeitraums 2007-2013 besteht in der Steigerung der Anpassungsfähigkeit von Arbeitnehmern, Unternehmen und Unternehmern zur besseren Vorwegnahme und Bewältigung des wirtschaftlichen Wandels. Im Rahmen dieser Priorität unterstützt der ESF die Modernisierung und Stärkung von Arbeitsmarkteinrichtungen, aktiven arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und – auch innerbetrieblichen – Maßnahmen des lebenslangen Lernens.
Der ESF befasst sich weiterhin mit der Lösung von Beschäftigungsfragen im Hinblick auf den Zugang zum Arbeitsmarkt und die Förderung der Erwerbsbeteiligung. Hinzu kommen seine Anstrengungen zur Vermeidung sozialer Ausgrenzung und zur Bekämpfung der Diskriminierung durch Sicherstellung von Zugang und sozialer Eingliederung „benachteiligter Arbeitnehmer“.
Seit 2007 unterstützt der ESF auch den Kapazitätsaufbau öffentlicher Einrichtungen zur Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen und Dienstleistungen. Der ESF trägt auch zur Förderung von Partnerschaften zwischen Arbeitgebern, Gewerkschaften, NRO und öffentlichen Verwaltungen bei, um Reformen in den Bereichen Beschäftigung und Eingliederung zu ermöglichen.
Transnationale Zusammenarbeit und Innovation sind in allen ESF-Maßnahmen verankert.
Quelle: Europäischer Sozialfonds - 50 Jahre Investitionen in Menschen - ISBN 92-79-03355-7
