Hinter den verschlossenen Türen Brüssels: Wie ich die EU-Politik erkundete und die öffentliche Wahrnehmung ändern will
- 29 Jan 2025
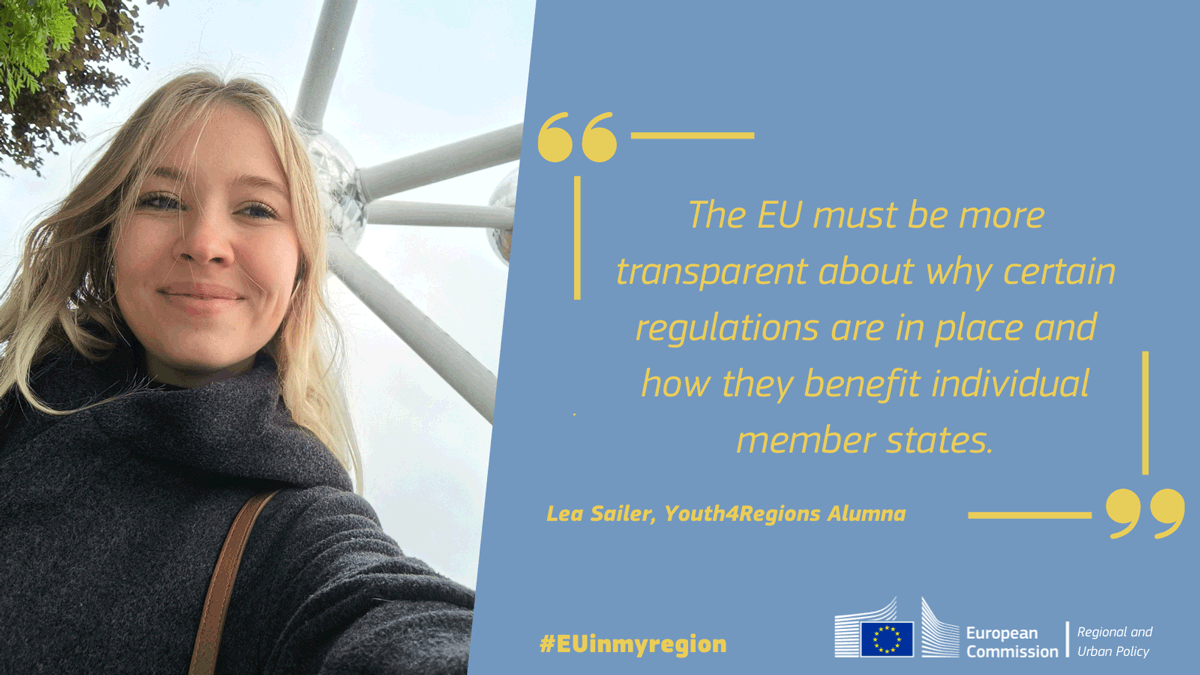
„Diese neuen Flaschendeckel machen mich irre!“
„Gurken dürfen nicht mehr gekrümmt sein? Das ist doch lächerlich!“
„Das Renaturierungsgesetz treibt unsere landwirtschaftlichen Betriebe in den Ruin.“
„Sie verschwenden unsere Steuergelder.“
Sätze wie diese fallen in der österreichischen Gesellschaft häufig. Die Beziehung zwischen Österreich und der EU ist schon lange von Skepsis geprägt, meist angefacht durch mangelndes Wissen und der Tendenz, die Schuld für nationale Probleme bei „denen in Brüssel“ zu suchen. Als ich für das Programm Youth4Regions nach Brüssel kam, war das mein erster Besuch. Das Herz der EU – was konnte ich erwarten? Ich bin zwar an Politik interessiert, doch meine Meinung zur EU war vage – wie eine entfernte Institution, die die meisten Menschen nie betreten werden. Ich wollte die Arbeitsweise besser verstehen.
Vor der Abreise überlegte ich, warum das Misstrauen gegenüber der EU in Österreich so groß ist. Ich habe zwar im Großen und Ganzen darauf vertraut, dass die EU im Sinne der Bürgerinnen und Bürger handelt, aber viele sehen das anders. Eine Umfrage in Österreich aus Juni 2024 ergab, das 76 % der Bevölkerung dafür waren, das das Land in der Europäischen Union bleibt. Im Jahr 2023 sahen allerdings nur 42 Prozent der Menschen in Österreich die EU-Mitgliedschaft als etwas Positives an. In anderen Ländern wie Italien, der Tschechischen Republik, Ungarn und Frankreich sind ähnliche Trends zu beobachten. Das Vereinigte Königreich verließ 2020 als erstes Land die EU.
In Österreich zeigt sich die Stimmung in der wachsenden Beliebtheit der Freiheitlichen Partei (FPÖ). Der Bundesparteiobmann Herbert Kickl will derzeit keinen EU-Austritt, stellt die EU aber oft als Bedrohung dar. Vor der Europawahl hieß es auf einem Plakat: „EU-Wahnsinn stoppen“. Die FPÖ erreichte in der Europawahl 25,4 % und bei der Nationalratswahl am 29. September 28,8 %.
Warum ist die EU in vielen Mitgliedstaaten so unbeliebt, auch in Österreich?
Skepsis und eine Abhilfe
Österreich ist der EU 1995 beigetreten und kämpft noch immer mit Bedenken hinsichtlich der Souveränität. Viele Menschen denken, dass die EU-Mitgliedschaft sich auf die Neutralität auswirkt. Ich bin in der EU aufgewachsen und empfinde das nicht so stark. Die politischen Parteien in Österreich, besonders Parteien wie die FPÖ, haben diese Skepsis angefacht, indem sie die EU als eine externe Kraft darstellen, die lokale Realitäten ignoriert.
In meiner Zeit in Brüssel habe ich Einrichtungen besichtigt, mir Pressekonferenzen angehört und mit EU-Bediensteten gesprochen, die sich als sachkundig und kompetent erwiesen. In Sitzungen zur Kohäsionspolitik erkannte ich, wie viele lokale Projekte über die EU finanziert werden, auch wenn die Menschen das oft nicht wissen. Durch diese Erfahrung kann ich übersehene Details jetzt besser verstehen.
Ich kann noch immer verstehen, dass einige EU-Verordnungen wie das Gesetz zur Krümmung der Gurke (2009 abgeschafft) absurd klingen. Das Ziel solcher Verordnungen ist Standardisierung, doch die Gründe bleiben für die Öffentlichkeit meist unklar. Die EU könnte ihre Beschlüsse besser erklären, um schlechte Kommunikation zu vermeiden. Das ist vermutlich der Schlüssel, um das Narrativ zu ändern. Die EU muss zu den Gründen für Vorschriften und die Vorteile für einzelne Mitgliedstaaten transparent sein. Der direkte Kontakt mit der Bevölkerung, Kenntnis zu deren Sorgen und das Aufzeigen von Vorteilen wird das Gefühl der Entfremdung verringern.
Auch Bildung ist wichtig. Viele Menschen in Österreich wissen kaum, wie die EU arbeitet. Mit zugänglicheren Ressourcen kann die EU besser nachweisen, dass sie keine überholte Bürokratie ist, sondern ein Zusammenschluss von Nationen, die an gemeinsamen Zielen arbeiten.
Eine persönliche Meinungsänderung
Nach der Woche für Youth4Regions sah ich die EU mit anderen Augen. Ich habe die Komplexität der behandelten Probleme aus erster Hand erfahren und die Anstrengung wahrgenommen, mit der die vielfältigen Bedürfnisse der Mitgliedstaaten ausgeglichen werden. Bei den Veranstaltungen zur Kohäsionspolitik habe ich erfahren, wie viele kleine Projekte die EU fördert, obwohl die Menschen meist nicht wissen, dass die EU sich direkt für ihre Dörfer, Straßen oder Lebensmittel einsetzt.
Die EU ist nicht makellos und es besteht viel Raum für Verbesserungen, doch ich erkenne jetzt deutlicher, dass viele politische Maßnahmen auf das langfristige Wohlergehen aller Bürgerinnen und Bürger ausgerichtet sind.
Die EU ist sehr komplex. Und ich kann verstehen, dass wenn die Zeit oder Energie fehlt, sich mit ihr zu beschäftigen, die EU sehr abstrakt und verwirrend erscheint. Ich hoffe, in Zukunft in Österreich zu einer besser informierten Debatte über die EU beizutragen. Dadurch, dass ich meine Erfahrungen mitteile, möchte ich die Kluft zwischen der österreichischen Bevölkerung und dem europäischen Projekt überwinden und einen Dialog schaffen, der kritisch und dennoch konstruktiv ist.
Je mehr wir über etwas wissen, desto weniger angsteinflößend erscheint es. Und mit weniger Angst ist es einfacher, miteinander auszukommen.


